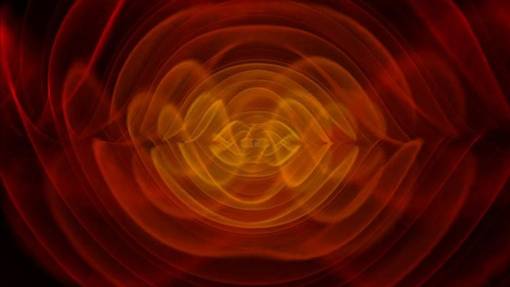#Bildung #Wissenschaft #Wissenschaftskommunikation
Andernorts
István Takács, Alumnus bei Master Plus, Stipendiat bei Dissertation Plus
Im September 2020 habe ich bei dem jährlichen Get-together der Claussen-Simon-Stiftung einen Workshop angeboten. Das Format hatte ich eigentlich für das traditionelle Stipendiatentreffen in Ratzeburg entworfen, aber das meiste davon ließ sich im Ausnahmejahr 2020 auch ganz gut ins Zoomsche übersetzen. Beim Workshop ging es darum, wie man sich am besten an Fremdsprachen herantastet. Dementsprechend haben wir uns in der Runde darauf fokussiert, wie man in ganz konkreten Schritten eine zusätzliche Sprache in seinen Alltag integrieren kann: mit Apps, Tagebuchführen, Serienschauen, Tandems, Reisen usw. Was beim Workshop zu kurz kam: Warum sollte man das überhaupt wollen? Die Antworten auf diese Frage können vom offensichtlichen „sieht gut im Lebenslauf aus“ bis hin zum Humboldtschen „Sprachen als Schlüssel zur Welt“ variieren. Statt der Bekräftigung solcher ohnehin schon kräftigen Antwortansätze geht dieser Text andernarts vor. Es folge: illustrative Verwirrung.
Fremdsprachen im Alltag „wollen“. Warum? „Wollen“ ist – unabhängig von der konkreten Begierde – eine unliebsame Angelegenheit. Jedes „ich will {…}“ kann nämlich ganz schnell zu einer Art Stellungnahme bezüglich der Themenfelder Zeitlichkeit, Kausalität oder gar der Willensfreiheit werden. Spulen wir mal zurück. Im Englischen bildet man das Futur mithilfe des Modalverbs „will“ – aus dem Protogermanischen willjan = dt. „wollen“. Eine Formulierung wie „I will go“ geht also auf ein gewisses Wollen zurück. Es gab eine Zeit, da schwang „I wish to go“ beim „I will go“ immer mit. Wenn man nicht gerade viel zu viel Schopenhauer gelesen hat, ist dieses Mitschwingen ziemlich kontraintuitiv. Warum sollte man eine Ausdrucksvariante des Wünschens so leichtfertig auf die Domäne des Zukünftigen übertragen? Schließlich gilt: „you can’t always get what you want.“ Ob nun kontraintuitiv oder nicht, dieses Anschmiegsame zwischen Wollen und Werden hat sich nicht nur im Englischen etabliert. In vielen Balkansprachen bildet man das Futur ebenso mithilfe des Verbs „wollen“ – oder eben mit einer verkürzten Variante davon.
Im Griechischen heißt „ich will“ θέλω, also: „thélo.“ Hier ein ganz banaler Satz: θέλει αλάτι / „théli aláti“, also wortwörtlich: „er / sie / es will Salz.“ Nur dass dieser Alltagssatz eigentlich so gut wie nie „er / sie / es will Salz“ bedeutet. Wer nach dem Kosten der Avgolemono θέλει αλάτι sagt, meint: die Suppe hier will Salz. Das klingt eigenartig. Suppen können ja kein Salz wollen. Wenn man beim Kochen das Salz vergessen hat, braucht die Suppe halt noch etwas Salz. Dabei übersieht man leicht, dass es egal ist, ob die Suppe Salz will oder braucht. Wir reden ja in beiden Fällen von Metaphern. Entmetaphorisiert klänge das Ganze eher so: „Ich brauche Salz in der Suppe“ (um die Suppe genießen zu können); alternativ: „Wir wollen Salz in der Suppe haben“ (denn wir wollen, dass uns die Suppe schmeckt). Der Suppe hingegen ist das alles ziemlich wumpe. Sie will nichts. Sie braucht nichts. Was in die Domäne des Wünschens und was in die des Benötigens gehört, liegt ganz im Ermessen der Köche. Oder eben: der Sprecher. Wie der Poet schon sagte: “you can’t always get what you want…” und so weiter und so fort, bis hin zum stoischen „what you need.“
Im Deutschen kann man „ich will“ auch durch „ich habe vor“ ersetzen. Damit wären wir wieder bei der Konvergenz von Wollen und Werden. Etwas wollen und etwas vor (sich) haben sind eng beieinander. Das Wollen scheint die Flugbahn zu sein, die mich von A nach B bringt. Ich habe etwas vor. Mir steht etwas bevor. Beides geht auf die gleiche Beobachtung zurück: Was in der Zukunft „liegt“, ist irgendwo „vor mir“. Das Deutsche stellt da noch eine zweite Diagnose: Was auch immer vor mir liegt, es rast auf mich hinzu (zu + kunft; für die Latein-Nerds: ad + vent). Aber nicht jede Sprache arbeitet mit den gleichen Raum-Zeitlichkeits-Prämissen. In Aymara liegt die Vergangenheit vor mir, die Zukunft hinter mir. Logisch. Die Vergangenheit sehe ich ja, sie ist mir bekannt. Die Zukunft hingegen ist unbekannt, heißt: Ich stehe mit dem Rücken zu ihr. Etwas auf Aymara vor (sich) haben, wäre nichts anderes, als in Erinnerungen schwelgen; statt dass man – wie jeder anständige Zu+kunftianer – in seinen Vorhaben schwelgt. Worauf ich hinaus will: Das Konzept des Habens (ob nun „Vor-“ oder nicht) ist nicht weniger knifflig als das des Wollens. Weswegen man mancherorts sich das Haben einfach spart. Im Ungarischen gibt es gar kein Pendant zu „haben“. Es gibt „besitzen“ und „über etwas verfügen“, aber nach „haben“ / „have“ / „avoir“ kann man in der Puszta lange suchen. So etwas wie „Hast du eine Minute?“ kann man natürlich trotzdem leicht ausdrücken: „van egy perced?“, also „ist“ + „eine Minute“ + Possessivpronomen. Sprich: „ist (dir) deine eine Minute?“ „Ich habe“ ist hier also im Grunde ein „mir ist“. Ich habe etwas vor (mir). Mir steht eine Minute bevor.
Ich habe eine Landkarte. Mir ist eine Landkarte. Hier ein Land, dort ein Land. Estland, Irland, Griechenland. Man blicke weiter nach Osten. Zentralasien. Hier ein Stan, dort ein Stan: Kasachstan, Pakistan, Tadschikistan. „Stan“ als Suffix bestimmt – kann man sich schon denken – Orte. Eigentlich sollte man „Stan“ eher als „Zuhause von…“ übersetzen. Also das Zuhause der Kasachen usw. Im Persischen kommt das Suffix „-stan“ aber nicht nur bei geopolitischen Themen zum Einsatz. بیمارستان (bimar-e-stan) heißt zum Beispiel Krankenhaus – also „Ort / Heim der Kranken.“ Ähnlich bildet man die Wörter تابستان (tab-e-stan) und زمستان (zem-e-stan). Wort für Wort: „der Ort der Wärme“ beziehungsweise „der Ort der Kälte“. Geht es dabei um Öfen und Tiefkühlfächer? Oder um Wüstengegenden versus Gebirge? Nein. تابستان und زمستان bedeuten schlichtweg Sommer und Winter. Die Wörter geben einfach die Koordinaten der Hitze und des Frosts wieder. Sie bestimmen, wo Schwitzen und Frieren beheimatet sind. Erneut eine Raum-Zeitlichkeits-Intuition.
Warum sollte man sich in Fremdsprachenproblematiken involvieren? Lebenslauf? Humboldt? Metaphern? Die oben angeführten persischen Raum-Zeit-Verschränkungen sind den meisten Leuten in Shiraz genauso wenig geläufig wie den meisten Hamburgern die geschichtsphilosophischen Konnotationen des Wortes „Zukunft“. Man muss diese Aspekte in einem Sprachkurs gar nicht erfahren, um sich auf den Straßen Teherans oder Berlin zurechtzufinden. Andererseits gibt es in jeder Sprache durchaus Elemente, die einen immer wieder zu kognitiver Akrobatik zwingen. Wer sich sein Leben lang auf „haben“ oder „have“ oder „avoir“ stützen konnte, wird ganz schön staunen, dass es in der Puszta auch sans avoir geht. Oder: Denjenigen, die eine Sprache sprechen, in der die Verben immer direkt nach den relevanten Substantiven kommen, wird die halsbrecherische Satzstellung des Deutschen auch trotz aller Ambition und Disziplin selbst nach jahrelanger Übung immer wieder alles – huh, und schon sind wir beim Verb: – abverlangen.
Die ganze Fremdsprachenproblematik lässt sich aber nicht auf solche linguistischen Kuriositäten reduzieren. Denn die Problematik besteht ja nicht darin: „Fremdsprachen lernen.“ In gewisser Hinsicht verdeckt die Formulierung „Fremdsprache lernen“ genauso viel wie die Suppe, die dies oder jener „will“ oder „braucht“. Wir lernen – wenn wir das mal gründlich ausbuchstabieren wollen – nie eine Fremdsprache. Einen „specific set of skills“ namens Fremdsprache gibt es ja nirgends. Was wir im Idealfall tun, ist zu lernen, uns mit Menschen, die andernorts sprechen, zu verständigen. Deswegen begegnet man immer wieder Personen – und ich gehöre dazu –, die nach sechs bis acht Jahren Schulfranzösisch bestenfalls ein je suis desolé, mais… zusammenkriegen. Wenn man im Sprachunterricht Vokabeln in verlückentextifizierter Form völlig losgelöst von ihrer möglichen Anwendung gegenübersteht, muss man ziemlich viel Fantasie mitbringen, um zu erkennen, dass das eventuell mal dazu führen könnte, sich mit Menschen, die andernorts sprechen, zu verständigen. Also um die eigentliche Frage, die hinter der Fremdsprachenproblematik steht, zu formulieren: Warum sollte man anderorts sprechen können wollen?
Ich setze auf: „um in einem kontrollierten Setting regelmäßig den Boden unter den Füßen zu verlieren.“ Und schicke nach: „um zu erfahren, wo man ist, wenn man an dem Punkt angelangt ist, an dem die eigenen Selbstverständlichkeiten einen nicht mehr weiterbringen.“
2020 haben fast alle, die ich kenne, gehamstert. Ich meine nicht Toilettenpapier, sondern: neue Selbstverständlichkeiten, neue Rituale, neue Risikoeinschätzungsberechnungen. Neue Selbstverständlichkeiten hamstern war die Strategie, um – angesichts all dessen, was 2020 in petto hatte – mit der eigenen Hilflosigkeit zurande zu kommen. Atemübungen, Brotbacken, Kombuchabrauen, Kleingärtnern, Aktienhandel, Joggen, Onlinekurse, Spenden, Zuhören, Ausrasten, Ausmisten, Aushalten. Alles legitim. Auch ich habe da meine neuen Playlists, neuen Rezepte, neuen moves. Wenn man aber noch nicht fündig wurde und versucht, die eigenen 30 m2 nicht zu eng werden zu lassen, empfiehlt sich: andernorts sprechen.
Das kann man mithilfe von Apps (mäßig), Onlinekursen (viel besser), oder (online/outdoor) Begegnungen (top). Für diejenigen, die gar nicht wissen, wo man da ansetzt, gibt es im Netz genügend Anlaufstellen. Für diejenigen, denen das know to zu mühselig wäre, aber die das ganze know how spannend finden, gibt es auch Kanäle. Sonstige Eigenarten alles Sprachlichen gibt es in konkret oder allgemein. Andernorts sprechen ist affig. Es ist politisch. Es ist Ästhetik. Es ist Leben.
Es ist halt so eine Sache.
Artikel kommentieren
Kommentare sind nach einer redaktionellen Prüfung öffentlich sichtbar.